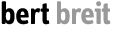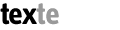Von der Prostitution
[1983]
von Bert Breit
In dem System, das sie gemacht haben,
ist Menschlichkeit eine Ausnahme.
Bert Brecht
Die Prostitution, das heißt, der Verkauf der zeitlich begrenzten Verfügung über den eigenen Körper an anonyme Käufer ist ein inhumaner Handel, auch wenn dieses Geschäft noch so romantisch verbrämt, noch so diskret abgewickelt wird.
Dieser Standpunkt könnte mißverstanden werden. Die Zustimmung von der falschen Seite möchte ich zurückweisen: die Zustimmung jener Leute zum Beispiel, die, weil sie sich für anständig halten und gegen diese – wie sie sagen – »größte Plage der Menschheit« sind, die Prostitution verbieten oder in Sperrbezirke abdrängen wollen, um die Prostituierten noch mehr als bisher zu isolieren, um sie noch mehr als bisher der Vereinsamung und der allgemeinen Verachtung auszusetzen.
Daß es die Prostitution gibt, kann man nicht »lustbesessenen«, »verdorbenen« Frauen anlasten, die auf einem Markt, der ausschließlich zur Befriedigung männlicher Bedürfnisse entstanden ist, ihre Arbeit tun. Die Prostitution in ihrer heutigen Form hat sich konsequent, mit zynischer Logik, aus den Regeln und Wertvorstellungen, die für unsere Gesellschaft verbindlich sind, entwickelt. Diese Regeln und Wertvorstellungen bewirken nicht nur, daß der Reiche den Armen, der Mächtige den Machtlosen und der Mann die Frau ausbeuten kann. Sie wirken auch in das Leben jedes einzelnen hinein. Ausbeutung, Machtkämpfe und Ungleichheit prägen die privaten Beziehungen der Menschen untereinander. Prostitution ist ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Verhältnisse.
Wirklich humane Formen von Freundschaft, Liebe und Sexualität können sich nur unter Gleichen, unter Gleichgestellten und Gleichberechtigten entfalten. Nicht unter Menschen, die gezwungen sind, nach dem Wolfsgesetz zu leben.
Die Prostitution ist ins Gerede gekommen. Das hat seinen Grund. Ein mächtiger Konkurrent für jene, die an der Prostitution Millionen verdienen, ein mächtiger Konkurrent also für Zuhälter, Bordell- und Nachtlokalchefs, für die Vermieter einschlägiger Wohnungen (bis zum Sommer 1983 waren auch Besitzer von Massenzeitungen mit von der Partie) drängt sich in den Markt: der Staat. Der Staat will in Hinkunft auch verdienen an der Prostitution; und zwar durch die Besteuerung des sogenannten Schandlohns, den die Frauen, die auf den Strich gehen, von den Kunden kassieren.
In einer Meldung der Austria Presse Agentur vom 7. April 1983, die auch vom ORF verbreitet wurde, heißt es: »Mit einem am 16. Februar ergangenen Urteil (Geschäftszahl 82/!3/0202, 0215) bittet der Verwaltungsgerichtshof die 'Schönen der Nacht' zur Kasse« ( … ).« Damit wurde erstmals in Österreich von einer Höchstinstanz die Steuerpflicht des 'ältesten Gewerbes der Welt' bestätigt. Während das Finanzamt der Wiener Prostituierten Emanuela Z., 18, die den Fall ins Rollen gebracht hatte, unter dem Titel 'sonstige Einkünfte' Steuervorschreibungen in der Höhe von 200.000 Schilling ins Haus geschickt hat, stufte der Verwaltungsgerichtshof den Verdienst der 'Dame' als 'Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb' ein«.
Heimische Schreiber unterschiedlichsten Niveaus griffen das Thema auf ihre Weise auf. Wortreich, bissig oder hämisch schilderten sie die praktischen Konsequenzen aus dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Über die Frage, welches Gewerbe die Prostitution denn nun sei – ein eher freies, ein gebundenes, ein konzessioniertes, das allerdings erst nach einer entsprechenden Prüfung ausgeübt werden dürfte –, wurde genüßlich gewitzelt. Viel Spaß fand man auch daran, sich auszumalen, wie die Prostituierten mit ihren Kunden die Schandlohnverrechnung abzuwickeln hätten. Professor Dr. Ernst Gass schreibt im Profil vom 9. Mai 1983, daß die Prostitution als »jüngste« Sektion ihren Einzug in die Handelskammer halten werde und schließt seine unangebrachte Satire mit dem Satz: »Wie tief muß ein Staat gesunken sein, wenn er sich in seiner krampfhaften Suche zur Erschließung einer neuen Steuerpfründe genötigt sieht, einen halbseidenen Rettungsanker auszuwerfen«.
Nun, Empörung darüber, daß der Staat sich offenbar nicht zu schlecht ist, von den Frauen, die sexuelle Dienstleistungen verkaufen, Geld zu nehmen, ist nicht am Platz.
Ein Staat, dessen Fundament der Kapitalismus ist, handelt logisch, wenn er sich an allen nur möglichen Geschäften beteiligt. Von der Geschichte her gesehen, befindet sich der Staat – wenn er die sogenannte Hurensteuer einhebt, in feinster Gesellschaft. Immer wieder im Lauf der Jahrhunderte zwangen kirchliche und profane Machthaber die Prostituierten zu hohen Abgaben und verdienten damit mehr als alle Bordellwirte, Lusthauspächter, Kuppler und sonstigen Ausnützer der Frauen zusammen.
So betrieb Papst Sixtus IV. (1471-1484) Staatsbordelle, die ihm erhebliche Einnahmen brachten; im Jahr sollen es über 20.000 Dukaten gewesen sein. Sixtus IV. wies einen Teil der Einnahmen seinen Geistlichen als Pfründe an. Agrippina von Nettesheim berichtet 1564, wie diese Pfründe taxiert wurden (zitiert nach Dr. med. Iwan Bloch): »Er hat zwei Benefizien, ein Kurat mit 20 Dukaten, ein Priorat mit 40 Dukaten und drei Dirnen im Bordell (tres putanas in Burdello), die jede Woche 20 Julier entrichten«. Der Erzbischof von Mainz hob bis Mitte des XV. Jahrhunderts die sogenannte Unzuchtsteuer ein. Im 19. Jahrhundert wurde die Prostitution in Frankfurt als Gewerbe anerkannt, das heißt, sie wurde besteuert. 36 Frauenhäuser wurden konzessioniert, für jedes Haus war ein Sergeant, der auch die Steuern zu kassieren hatte, zuständig. Fast alle Städte Deutschlands, Spaniens und Frankreichs betrieben zeitweise Bordelle, die sie oft gegen hohen Pacht an privater Unternehmer weitergaben.
Auch aus einem anderen Grund ist Empörung über die Absicht des Staates, die Hurensteuer zu kassieren, nicht am Platz: Daß der Staat Steuern bei den Prostituierten einheben will, läßt noch nicht auf eine besonders niedrige Staatsmoral schließen. Erst wenn man danach fragt, was der Staat für seine, ihm Steuern zahlenden Bürgerinnen, für die Frauen, die sich prostituieren, zu tun gedenkt, erst dann zeigt sich's, wie weit es her ist mit der staatlichen Moral. Will er – der Staat – den Frauen den Zugang zu Sozialversicherung, zu Altersversorgung und zu anderen Hilfen erleichtern? Will er die Prostituierten in ihren Bemühungen, Freudenhäuser in Selbstverwaltung – ohne die üblichen Mitverdiener – zu eröffnen, unterstützen? Will er die Frauen wirksamer als bisher vor Diskriminierung und Erpressung schützen? Mit einem Wort – will er die Prostituierten als normale Bürgerinnen, mit allen Rechten und Pflichten, voll anerkennen? Erst wenn klar ist, daß der Staat nur nehmen und nichts geben will, erst dann muß man sich empören; dann ist die Moral des Staates wirklich eine üble.
Anläßlich einer Diskussion: Es geht um die Prostitution. Eingeladen sind vor allem Männer. Dazu eine Prostituierte und eine Sozialarbeiterin. Der Herr Durchschnittsösterreicher sagt, daß er die Prostitution an und für sich ablehne. Der gevifte Hostessenwohnungsvermieter sagt, daß die Prostituierten wichtig seien für die Krüppel, die Kontaktlosen, die Komplexbeladenen und Perverslinge. Die Sozialarbeiterin sagt, daß die Männer die Prostituierten bräuchten, um ihre Machtgelüste zu befriedigen.
Der Schriftsteller schwärmt von der großen Hure, die, selbst Lust empfindend, die geheimsten Wünsche erfüllt und dazu da ist, alle Männer – auf Verlangen – zu demütigen, zu Sklaven zu machen. Man ist sich ziemlich einig: die Prostituierten befriedigen mit ihrer Arbeit vorhandene Bedürfnisse, sie erfüllen eine Funktion in der Gesellschaft. Sobald es in der Diskussion aber um die Frage geht: Wie kann die Lebenssituation der Prostituierten in Österreich verbessert werden zeigt sich was Männern dazu einfällt. Wenn die Sozialarbeiterin vom Umgang der Polizei mit den Prostituierten, wenn sie von Bestechung und schikanösen Geldstrafen redet, wischt der Polizeivertreter diese Vorwürde – eilfertig unterstützt vom Herrn Hostessenwohnungsvermieter (warum wohl?) mit einem knappen Satz vom Tisch. Wenn die Prostituierte sagt, sie würde gern Steuern zahlen, falls sie die Möglichkeit bekäme, staatlichen Versicherungsschutz und staatliche Altersversorgung in Anspruch nehmen zu können, gibt man ihr den Rat, sie möge sich doch mit anderen Frauen zusammentun, um ihre Forderungen durchzusetzen. Von aktiver Hilfe, etwa beim Aufbau einer Organisation, die offiziell für die Rechte der Prostituierten eintreten könnte, war nicht die Rede. Es wäre wohl nahegelegen, nach der Solidarität der Gesellschaftsveränderer zu fragen. Und – es wäre wohl nahegelegen, in einem Land, das sich katholisch nennt, nach dem Engagement der Katholiken zu fragen.Österreich (im März 1980)
Wiener Prostituierte verteilen ein Flugblatt. Ihre Forderungen und Wünsche (zitiert aus: FORUM, Heft 317/18):
Im Wiener Gemeinderat wird über ein neues Gesetz, das die Prostitution regeln soll, diskutiert. Uns hat man bis jetzt nicht gefragt. Wir haben bis jetzt über folgende Punkte diskutiert:
1. Die Prostitution ist kein Verbrechen, sondern eine Dienstleistung. Ohne Nachfrage gibt es keine Prostitution. Wir fordern daher die Anerkennung der Prostitution als Beruf und rechtliche Gleichstellung von Prostituierten.
2. Der Gassenstrich wurde dort verboten, wo die Kunden aus Tradition hingehen. Die Folge war die Verlagerung der Prostitution in die Wohnungen. Das soll jetzt auch verboten werden. Wo sollen wir also hingehen? Der Wohnungsstrich ist eine Notlösung, die viele Nachteile hat, die Errichtung von Bordellen ebenfalls.
Wir halten den Gassenstrich in Verbindung mit Stundenhotels für die beste, traditionelle Lösung und fordern daher die Aufhebung der Sperrzonen! Wir sind bereit, Straßenbenützungsgebühren zu bezahlen. Über Bekleidungsvorschriften (tagsüber, wegen der Kinder) kann man ja reden.
Wir glauben aber auch, daß es die Möglichkeit von selbstverwalteten Häusern geben sollte. Die Frauen, die sich dafür interessieren, sollten beweisen können, daß sie dazu in der Lage sind.
3. Wir fordern eine einheitliche gesetzliche Sozialversicherung für Prostituierte. Das wäre auch ein Vorteil für den Staat, denn dadurch würde die Fürsorge entlastet.
4. Die Gesundheitskontrolle sollte anders als bisher gehandhabt werden. Man sollte einen Arzt eigener Wahl konsultieren dürfen.
5. Prostituierte sollten heiraten dürfen. Uneheliche Kinder und unverheiratete Frauen werden immer noch diskriminiert.
Im Fall der Trennung von ihrem Lebensgefährten hat die unverheiratete Frau außerdem keine Rechte (Güterteilung etc.).
6. Wir würden eine Servicestelle für Prostituierte für sinnvoll halten. Ihre Aufgaben sollten sein: Informationen über Gesetze und Möglichkeiten, Arbeitsvermittlung, Mütterberatung, Rechtsschutz etc. Die Servicestelle könnte nach dem Muster der Mietervereinigung aus monatlichen Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.
7. Wir wollen, daß die Bevölkerung über die wirklichen Zustände und Probleme informiert wird und Vorurteile (wie »Alle Huren saufen und raufen«) abgebaut werden.
Wir planen einen Videofilm und eventuell eine Zeitung.Frankreich
In Frankreich gib es die Organisation »Le Nid« (das Nest). Sie wurde von einem katholischen Priester gegründet. Diese Organisation hat in vielen Städten Kontaktstellen. Dort finden Prostituierte Hilfe und Rat, Ruhe und Aussprachemöglichkeiten. In den Heimen dieser Organisation können sich Prostituierte seelisch und körperlich erholen und neue menschliche Beziehungen anknüpfen, außerdem finden sie dort Schutz vor brutalen Zuhältern. Wenn eine Frau aus der Prostitution aussteigen will, hilft man ihr, einen Arbeitsplatz und eine Wohnung zu bekommen. Auch kann sie, gefördert durch »Le Nid«, einen Beruf erlernen. Daß sich 1975 in Lyon eine Gruppe von Prostituierten bildete, die bereit war, gemeinsam und solidarisch gegen das Unrecht, das ihnen von Staat und Polizei angetan wurde, zu kämpfen, ist dieser Organisation zu verdanken. Die Leute von »Le Nid« haben die Frauen nie bevormundet, aber sie haben ihnen einen Anwalt verschafft, sie haben ihnen Versammlungsräume zur Verfügung gestellt, sie haben ihnen wichtige Gesetzestexte kopiert. Der Aufsehen erregende Streik der Prostituierten von Lyon begann am 2. Juni 1975 in der Kirche Saint Nizier – mit Unterstützung durch die Organisation »Le Nid« und mit Zustimmung des Pfarrers dieser Kirche, Pater Béal.Italien
Pia und Carla, zwei Prostituierte, haben 1982 die »Bewegung von Bordenone«, das Komitee für die bürgerlichen Rechte, gegründet. Dieses Komitee, dem jeder Bürger – auch Kunden der Prostituierten – beitreten kann und dem jetzt schon viele Frauen verschiedener Berufe, Journalisten und Juristen angehören, hat sich zur Aufgabe gesetzt, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Prostituierten in Italien zu erkämpfen.
Die Zeitung, die die »Bewegung von Bordenone« im Rahmen der Kulturvereinigung A.R.C.I. herausgibt, will nicht nur Aufklärungsarbeit über die reale Lebenssituation der Prostituierten, die von Kontrollen, Übergriffen der Polizei und behördlicher Willkür geprägt ist, leisten; sie will vor allem die Änderung des Gesetzes Merlin vom Jahre 1958 durchsetzen.
»Dieses Gesetz« sagt Pia (dem Sinn nach in LUCCIOLE Nr. 1) »hob die Reglementierung auf und führte zur Schließung der Freudenhäuser. Dieses Gesetz sollte auch die Reintegration der Prostituierten in die Gesellschaft fördern und die Frauen vor der Ausbeutung durch andere schützen. Die Praxis heute aber zeigt, daß Prostituierte durch die freie, willkürliche Auslegung des Gesetzes in ihren Freiheiten wesentlich beschränkt, in die Isolierung getrieben und durch repressive Maßnahmen der Ordnungskräfte zunehmend kriminalisiert werden.«
»Wir Prostituierten haben uns in den letzten 20 Jahren geändert, also muss auch das Gesetz geändert werden.«
In mehreren Städten Italiens, in Como, in Bozen, in Genua, in Trient, in Orten an der ligurischen Küste, haben sich Prostituierte zusammengeschlossen, um solidarisch für ihre Rechte zu kämpfen.Versuch, über die Prostitution zu reden
Als ich begann, Fakten und Erfahrungen zum Thema Prostitution zu sammeln, reagierten Freunde und Bekannte auf recht verschiedene Weise. Die einen brachten, wenn's um die Prostitution ging, ihre alten, einschlägigen Witze an, die anderen waren scharf auf Details; die einen erklärten, daß sie dieses Thema ekelhaft fänden, die anderen machten sich Sorgen um meine Moral. Sie konnten – gerade noch – verstehen, daß ich »diese Damen« interviewe. Daß ich aber zu vielen der Mädchen und Frauen und deren Freunden gute Kontakte habe, sie immer wieder besuche und an ihrem privaten Leben teilhabe, begriffen sie nicht mehr.
Prostitution, das ist ein Thema, über das man in Österreich kaum sachlich und offen reden kann. Politiker pflegen oft nur Phrasen, die vor Doppelmoral triefen, zu dreschen, ihnen geht's – wie sie behaupten – um den Schutz der anständigen Bürger, vor allem um den Schutz der Kinder. Wenn Prostitution schon sein muß, dann heimlich, in geschlossenen Häusern, kaserniert, in finsteren Ecken und – vor allem – vom Staat eisern kontrolliert.
Wie unfrei das Verhältnis mancher Journalisten zur Prostitution ist, zeigen deren Reports und Berichte, die von einer distanzierenden, heruntermachenden, hämischen Sprachakrobatik geprägt sind, die nicht Information, sondern vor allem Unterhaltung im Sinn hat. Da lacht die Männerrunde, da freuen sich die kleinen Spießer und biederen Schulterklopfer, wenn man Prostituierte nicht Frauen nennt, sondern Lustarbeiterinnen, Bettartistinnen, Sexualprofessionistinnen usw. Eine der wenigen Ausnahmen: Horst Christoph in seinem Bericht (Profil), der ohne sprachliche Mätzchen und sachlich über das Thema schrieb.
Prostitution ist offenbar für viele ein Ärgernis. Ihre Existenz wollen wir nicht wahrhaben. Sie macht uns auf entscheidende Widersprüche, die in unserer kapitalistisch-patriarchalischen Gesellschaftsordnung begründet sind und unaufhebbar scheinen, aufmerksam.
Rudolf Kohoutek schreibt in seinen ausgezeichneten »Fünf Versuche über die Prostitution« (Kriminalsoziologische Biographie 1979/Jg. 6, Heft 23-24): »Prostitution verletzt Tabus von Liebe, Fruchtbarkeit, Ehe, Familie, Gegenseitigkeit, Monogamie, Verbindung Emotion-Sex, normales Einkommen einer ungelernten Frau, Hygiene, Verantwortung, Neurotisierbarkeit des heterosexuellen Koitus.« Weil die Prostitution viele von uns provoziert, bemühen wir uns nicht, die Wurzeln der Prostitution, wie sie sich heute abspielt, zu erkennen. Wir suchen lieber an der Oberfläche die Ursachen für dieses sogenannte »notwendige Übel«, das – präziser gesagt – wohl notwendig für die Männer sein mag, aber bis heute ein Übel für die Frauen ist.
Eines steht fest: Die Prostitution gibt es nicht, weil Frauen, die sich prostituieren, abnormal sind und besondere, prostitutive Anlagen haben. Die meisten Frauen wurden durch Armut, durch vielfältige Abhängigkeit auch aus Protest gegen diese Abhängigkeit, zur Schwerarbeit im Dienst der Männer – in Bordellen, Lusthäusern, Absteigequartieren oder sonstwo – gezwungen.
Die Prostitution in ihrer heutigen Form – ich folge den Gedanken Dorothea Röhrs (Universität Gießen) – ist als Begleiterscheinung der lebenslänglichen Einehe entstanden. Seinem Ehepartner ein Leben lang treu zu bleiben und nur mit ihm sexuelle Kontakte und ausschließlich zum Zweck der Fortpflanzung, nicht aber zur Befriedigung der Lust – so schrieb es die Kirche vor – zu pflegen, ist nur wenigen Menschen gelungen, ohne seelisch-psychische Schäden durch Triebverdrängung oder Triebverzicht zu erleiden. Monogames Verhalten entspricht nicht dem Wesen des Menschen Dorothea Röhr zitiert in ihrem ausgezeichneten Buch »Prostitution«, Sigmund Freud und führt seine Überlegungen weiter:»Ein im Leben wichtiger Charakter ist die Beweglichkeit der Libido, die Leichtigkeit, mit der sie von einem Objekt auf andere Objekte übergeht (…). Der Mensch ist nicht daraufhin angelegt, nur bei einem Partner Befriedigung zu finden, woraus allerdings nicht folgt, daß die Partner austauschbar wären (sonst könnte man bei einem bleiben); vielmehr bestimmt die Art des aus dem Es kommenden Triebanspruchs das Ich, ein ganz spezielles Objekt hic et nunc mit Libido zu besetzen. Das Ich kann mit der Objektsbesetzung auch auf einen vom Objekt ausgehenden Reiz antworten. In Ausnahmefällen mag es zu einer Libidofixierung auf ein Objekt kommen, die ein Leben lang anhält; in der Regel jedoch ruft die Monogamievorschrift Konflikte hervor. Die Triebansprüche, sofern sie nicht verschoben oder sublimiert werden können, müssen verdrängt werden. Gelingt das nicht, so kann durch den permanenten Konflikt zwischen Es, Ich und Über-Ich eine Neurose entstehen«.
Strikte Monogamie für Ehepartner und totale Enthaltsamkeit für die Nichtverheirateten – diese lust- und lebensfeindlichen Vorschriften konnten von der Mehrzahl der Menschen nicht eingehalten werden. Je konsequenter man den Untertanen diese Einschränkungen aufzwang, desto mehr entwickelte sich die für das frühe Mittelalter charakteristische, relativ freie Sexualität zu extremen Formen perverser Ausschweifung. Mehr Menschen denn je erkrankten psychisch, litten unter Wahnvorstellungen, an hysterischen Anfällen und Halluzinationen. Für die Männer gab es – wie schon immer, wenn auch in anderer Form – eine Möglichkeit der sexuellen Befriedigung außerhalb der Ehe. Als Ventil für ihre aufgestauten Wünsche und Bedürfnisse duldeten Kirche und Staat die Existenz der weiblichen Prostitution. Kirche und Staat, streng patriarchalisch strukturiert, gestanden den Männern also wesentlich mehr Freiheit zu als den Frauen. Frauen waren das Eigentum ihrer Männer, hatten Kinder zu haben, die Entfaltung ihrer Sexualität war ausschließlich an die Ehe gebunden.
Gordon Rattray Tailor schreibt in seiner Kulturgeschichte der Sexualität: … »und im Mittelalter ging es so weit, daß die verheirateten Frauen keine legale Existenz mehr besaßen. Sicher, unverheiratete Frauen hatten noch gewisse gesetzliche Rechte und konnten, sobald sie mündig waren, über ihr Eigentum verfügen, die verheirateten aber waren nur noch die Schatten ihrer Ehemänner.«
Die Kirche duldete also die Prostitution. Thomas von Aquin sagte (sinngemäß): So wie es die Kloake geben müsse, damit die Paläste sauber blieben, so sei die Prostitution eine notwendige Bedingung für die allgemeine Sittlichkeit. Siebenhundert Jahre später muß man die Existenz der Prostitution immer noch mit ähnlichen Argumenten begründen. Josef Kühn erklärt 1892: »Die Prostitution ist nicht bloß ein zu duldendes, sondern ein notwendiges Übel, denn sie schützt die Weiber vor Untreue und die Tugend vor Angriffen und somit vor dem Falle.« Und heute? An die Monogamievorschriften fühlen sich längst nicht mehr alle gebunden. Ehen können (vom Gesetz her) beliebig oft eingegangen und wieder – meist zum Nachteil der Ehefrauen und der Kinder – geschieden werden. Viele behaupten, daß wir in Zeiten totaler sexueller Freiheit leben. Diese sogenannte Freiheit – und das ist typisch für eine Gesellschaft, in der die Ungleichheit in allen nur möglichen Varianten herrscht – diese sogenannte Freiheit hat keineswegs die Entwicklung einer menschenfreundlichen, phantasiereichen, lustvollen Sexualkultur gefördert.
Zur Situation in Österreich
Prostitution für die feinen Kreise, für die Oberschicht, scheint in keiner offiziellen Statistik auf; sie floriert – ungestört von Polizei und Tugendwächtern – wie schon immer. Wenn gestreßte Politiker Entspannung suchen, wenn bessere Herren sich anläßlich von Kongressen und Tagungen zusammenfinden und Probleme mit der Einsamkeit in der Freizeit haben, wenn's um wichtige Abschlüsse, um Geschäfte, um Industriespionage oder um die feine Art der Erpressung geht: straff organisierte Callgirlringe und Spezialagenturen vermitteln die passenden Partnerinnen; je nach Wunsch vom Typ Schulmädchen, vom Typ Studentin, vom Typ Gesellschaftsdame oder vom Typ Hausmütterchen.
Für die Kunden der Mittel- und Unterschicht gibt es in Österreich die teils geduldete, teil verbotene, aber kontrollierte Prostitution. Also die Straßen-, Wohnungs-, Lokal- und Bordellprostitution. In den einzelnen Bundesländern regeln eigene Gesetze und Verordnungen, wo und unter welchen Umständen Prostituierte ihre Arbeit tun dürfen. In Vorarlberg zum Beispiel gibt es offiziell keine Prostitution, weil sie – wenn überhaupt – nur in einem Bordell erlaubt wäre. Da keiner Gemeinde die »Schande« auf sich nehmen will, innerhalb ihrer Grenzen ein Bordell zu dulden, blüht die geheime Prostitution und damit die szenetypische Kriminalität wie kaum woanders in Österreich. In Tirol ist (in Innsbruck) ein Bordell zugelassen, Straßen- und Wohnungsstrich sind nicht erlaubt. Das scheint die Kunden nicht zu stören: die Frauen in den Wohnungen und auf der Straße verdienen mehr als die Bordellprostituierten.
Seit der Suchtgiftkonsum zugenommen hat, ist eine neue Form der Prostitution, die Drogenprostitution, entstanden. Sie wuchert wild, ist noch wenig organisiert, reicht in alle Schichten und entwickelt ihre eigenen Spielregeln; Regeln, die ihre Nutznießer bestimmen. Drogenprostituierte haben oft eine ganz besondere Sorte von Kunden. Ludwig P., verheiratet, zwei Kinder, Geschäftsmann, erklärt das so: »Mir sind die Giftlerinnen am liebsten. Erstens sind sie nicht so routiniert wie die Professionellen. Zweitens kann man den Preis drücken, weil sie immer ganz schnell Geld brauchen. Und drittens: Wenn sie nicht spuren, dann sag ich, ich bring' sie zur Polizei.«
Preisgünstig kommen auch Doktor Georg M., Apotheker, verheiratet, kinderlos, und ein paar Akademikerkollegen zu heimlichen sexuellen Genüssen: Gabriele, 17 Jahre, Schülerin, hatte sich, um ihren süchtigen Freund mit Tabletten versorgen zu können, bei Georg M. um eine Stelle in der Apotheke beworben.
Georg M. gab ihr die Stelle nicht, drängte ihr aber, als er ihre Zwangssituation durchschaut hatte, ein Tauschgeschäft auf: Tabletten für ihren Freund gegen Sex für ihn und ein paar nette Kollegen. Gabriele: »Das ging eine Weile so dahin. Schließlich hab' ich dann auch mit anderen Männern gegen Geld geschlafen – es war eh schon alles egal.«
Zwar wird die Gruppe jener Prostituierten, die sich von niemandem mehr ausnützen lassen will, die sich zu ihrem Beruf bekennt und vom Staat zurecht fordert, er möge Prostituierte als normale Bürgerinnen, als Arbeiterinnen anerkennen, größer. Das heißt nicht, daß die Frauen diesen Beruf freiwillig gewählt haben. Fast alle, die sich schon früh, als Minderjährige, prostituiert haben, wurden in die Prostitution hineingezwungen. Wer von Geburt an benachteiligt wird, wer keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit findet, wer täglich seine Zweitklassigkeit erleben muß und mit allen Erziehungsmitteln darauf konditioniert wird, in jeder Form zu »dienen«, wird durch Zwang zur Einsicht gebracht, daß »der Körper das einzige Kapital« ist, das sich einzusetzen lohnt im Kampf ums Überleben.
Fachleute und professionelle Zuhälter sind sich einig: ein relativ hoher Prozentsatz der Frauen, die sich (auf der Straße oder in Minibordellen) prostituieren, sind als Kinder und Jugendliche in Heimen eingesperrt und zwangserzogen worden.
Heimerziehung I
Die Leute mit hochbezahlten Berufen, Besitz und Vermögen – die sogenannten besseren Leute also – haben es leichter. Wenn sie ihre Kinder lang genug vernachlässigt, verwöhnt, emotionell ausgehungert, mit Geld abgespeist, mit repressiver Toleranz fertiggemacht haben und diese Kinder auf das, was man ihnen angetan oder vorenthalten hat, reagieren – mit Leistungsverweigerung, Normverletzung oder Selbstzerstörung- die besseren Leute können einiges dagegen unternehmen. Privat. Diskret. Ohne lästige Einmischung von Polizei und Jugendämtern. Die besseren Leute können zum Beispiel Psychiater und Sonderpädagogen zu Rate ziehen; sie können ihre ausgeflippten Töchter und Söhne in teure Privatinternate, in first-class Kliniken, in Spezialsanatorien stecken. Fachleute von Ruf, clevere Therapeuten und jede Menge Gurus stellen sich – gegen dickes Honorar versteht sich – bereitwillig zur Verfügung, um die seelischen und psychischen Schäden gestörter Kinder aus gutem Haus zu reparieren.
Für die kleinen, die niedergehaltenen Leute, für die Lohnabhängigen, die Wenigverdiener und Armen, die mit Überlebensproblemen (haben wir noch zu heizen?) und mit Schulden (wovon zahlen wir die nächste Miete?) überlastet sind und dankbar zu sein haben, daß sie, zu welchen Bedingungen immer, überhaupt arbeiten dürfen, gibt es dieses differenzierte Therapieangebot nicht, falls sie es nicht schaffen, ihre Kinder so aufzuziehen, daß dies, ohne aufzufallen, sich anpassen ans Bestehende. Aber weil die Wirtschaft und die Industrie willige angepaßte, mit allem zufriedene Arbeitskräfte brauchen, hat der Staat, der von Wirtschaft und Industrie abhängt, schon immer dafür gesorgt, daß auch die Kinder der geringen Leute, sobald sie die gesellschaftlichen Vorschriften verletzen, behandelt werden; selbstverständlich nicht so diskret, nicht so aufwendig, nicht so individuell wie die Kinder der besseren Leute.
Auf Antrag und Betreiben einschlägiger Ämter, oft unter zupackender Hilfe der Polizei, nimmt der Staat die Kinder der niederen Leute in öffentliche Fürsorge. Die staatliche Fürsorgeerziehung war nie dazu da, den männlichen und weiblichen Zöglingen aus der Unterschicht das zu bieten, worauf sie ein Recht hatten: eine vollwertige Schul- und Berufsausbildung in einer humanen, entwicklungsfördernden Umgebung.
Fürsorgeerziehung heißt für die Jugendlichen konkret: sich einsperren, sich demütigen und zerbrechen lassen; sich anpassen, Schläge und Isolierung erdulden. Gitter vor den Fenstern. Keine Außenkontakte. Unterdrückte Sexualität. Kaum Freundschaften. Verzicht auf normale Schul- und Berufsausbildung. Resozialisierung nannten das die Praktiker und Schreibtischtäter der öffentlichen Fürsorge. Versuche, die Heimerziehung offener, menschlicher zu gestalten, hat es mehrfach gegeben. Idealistische Erzieher, engagierte Pädagogen und kritisch denkende Fachleute haben sich vor allem in den letzten fünfzehn Jahren um Reformen bemüht und, gezwungen durch die permanenten Mißerfolge der herkömmlichen Fürsorgeerziehung, hat der Staat – in Einzelfällen – Reformen zugelassen.
Dennoch sind im Lauf der Jahrzehnte Tausende von männlichen und weiblichen Jugendlichen in Fürsorgeheime getrieben, behandelt und schließlich – als unerziehbar, scheinangepaßt, psychisch geschädigt entlassen worden: Voll von Lebenshunger, voll von Haß auf alles, mit äußerst geringen Berufs- und Lebenschancen. Wenige fanden sinnvolle Arbeit; viele isoliert, in Außenseiterrollen gedrängt, wurden kriminell. Die Mädchen, die aus den Heimen kamen, waren noch viel schlechter dran als die männlichen Fürsorgezöglinge. Sie schlugen sich durch als Küchenhilfen und Putzerinnen; sie ließen sich – notgedrungen – von Männern aushalten oder heiraten; sie arbeiteten stundenweise, aushilfsweise als Wäscherinnen und Fabriksarbeiterinnen. Oder sie landeten auf dem Strich (Angelika: …Ich möchte in einer Fabrik arbeiten. Es ist zwar nicht mein Traumberuf, aber es wird das Beste für mich sein …).
Heimerziehung II
Mädchen, die man in Heime einsperrte, wurden von Experten als verwahrlost bezeichnet. Verwahrlosung, das hieß bei Mädchen vor allem: sittliche (sexuelle). Schuld an der sittlichen Verwahrlosung seien die Mädchen selbst. Also hat man das Recht – die Pflicht – sie zu bestrafen; mit Heimeinweisung. Viele Mädchen wußten nicht, warum und wofür man sie bestrafte. Etwa dafür, daß sie, als sie noch Kinder waren, von Männern mißbraucht, genötigt wurden oder dafür, daß sie sich, um aus einer argen Klemme herauszukommen, von Männern erpressen und benutzen lassen mußten?
Sittliche Verwahrlosung heißt zum Beispiel bei Maria, daß sie, als sie neun Jahre alt war, vom Freund ihres Vaters gezwungen worden ist, ihm beim Onanieren behilflich zu sein. Regelmäßig. Als es aufkam, bestrafte man Maria mit Heimeinweisung. Bei Elisabeth nannte man sittliche Verwahrlosung, daß sie als Minderjährige »schon« bei ihrem Freund wohnte, weil sie zu wenig verdiente, um sich ein Zimmer leisten zu können. Zur Strafe wurde sie ins Heim eingewiesen. Und Hannelore beschuldigte man, sittlich verwahrlost zu sein, weil sie zweimal von Lehrplätzen davongelaufen war; bei der ersten Lehrstelle gab es nur schlechte Ausbildung, bei der zweiten wollte ihr der Chef dauernd unter die Bluse greifen. Heimeinweisung. Und Elfriede ist von Zuhältern in einen Keller gesperrt und mit vorgehaltener Pistole gezwungen worden, Gastarbeit zu befriedigen. Strafe für Elfi: Heimeinweisung.
Heimerziehung III
In vielen Mädchenheimen herrscht eine säuerliche, abgestandene, kleinkarrierte Moral. Schon immer herrschte dort die Moral. Früher war das eine offen grausame Moral, durchgesetzt mit unverhohlener Gewalt. Nicht etwa deshalb, weil das Heimpersonal aus Sadisten und Sadistinnen bestand, nahm diese Gewalt oft zerstörende, quälerische Formen an. Die Situation der Erzieherinnen und Erzieher war aussichtslos: Eingesperrte Jugendliche, die unter vielfachen Beschädigungen und Mängeln litten, im Sinn der bestehenden Ordnung zu »erziehen«, mußte scheitern. Die einsichtigen unter dem Heimpersonal, die zwar guten Willens waren, aber die Probleme rechtzeitig erkannten, wechselten den Beruf; andere resignierten, versahen ihre Arbeit »nach Vorschrift« mit kalter Routine. Und einige, fachlich unzureichend ausgebildet, unsicher gemacht durch ständig wechselnde Vorschriften, voller Haß auf die Jugendliche, die sie nicht »in den Griff« bekamen, entwickelten Methoden, um das, was die Sozialbürokratie von ihnen verlangte, mit Gewalt durchzusetzen. Einheitskleidung. Zwangshaarschnitt. Einheitsfrisur. Versperrte Schlafsäle mit Holzkübel als Gemeinschaftsklo. Tage und Nächte in der Korrektionszelle: 4 mal 2 Meter groß. Schwarze Wände. Holzboden. 1 Holzpritsche, 1 Kübel für die Notdurft. Die Salzergasse: Spießrutenlaufen durch die Reihen der Zöglinge: Ohrfeigen, Schläge, Kratzer. Und wieder zurück und noch einmal; solang es der Erzieherin paßt.
Schmutzige Unterhosen über den Kopf der Mädchen gestülpt, dann Stehen auf dem Gang zum Gespött der anderen. Eiskaltes Wasser aus dem Gartenschlauch auf den Unterleib der Mädchen.
Zwangsarbeit. Putzen. Waschen. Geschirrspülen. Abstauben. Socken flicken. Bügeln. Unter Akkordbedingungen, nur unbezahlt. Alles, was die künftige Ehefrau können muß.
Sonntags Kirche: den Blick geradeaus auf den Altar. Glaube (katholisch) ist Pflicht. Andacht ist Pflicht. Beten ist Pflicht. Singen ist Pflicht.
Beschimpfungen: Ihr Schweine, ihr Drecksäue, ihr mieses Pack, ihr verlogenen Ludern. Aus euch wird nie was. Hur bleibt Hur!
Drohungen: Wenn du nicht parierst, kommst du in ein anderes Heim. Vom viel zu strengen ins strengere, vom strengeren ins allerstrengste. Später: Die Türen der Heime öffnen sich einen Spalt. Die Strafsystem wechseln. Die nackte, rohe Gewalt entwickelt sich zur psychischen, zur strukturellen Gewalt. Strafen heißen nicht mehr Strafen. Gewährt man Zöglingen, was ihnen rechtmäßig zusteht, nennt man das Belohnung. Verweigert man ihnen, was ihnen rechtmäßig zusteht, nennt man das Entzug von Belohnung. Keine Korrektionszellen, keine Karzer mehr; dafür Besinnungsräume und Therapiestationen. Der vorletzte Schrei: Verhaltenstherapie, zum Heimgebrauch zurechtgebogen, dilettantisch praktiziert.
Sonderbehandlung ist möglich. Die Seelenspezialisten haben Konjunktur. Die befassen sich mit Einzelfällen. Mit Einzelfällen, die – sagen die Spezialisten – an individuellen Krankheiten leiden. Also wird individuell behandelt. Konkret: Die Einzelfälle werden ausgesondert, hospitalisiert, stigmatisiert. Ergebnis vieler solcher Therapien: Patient geheilt, aber Stigmatisierte sind auf dem Arbeitsmarkt nicht unterzubringen.
Vereinzelt entstanden in den letzten 15 Jahren neuere, offener Formen von Fürsorgeerziehung. Gesellschaftspolitisch engagierte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen entwickelten pädagogische Konzepte, die der Lebenssituation der Jugendlichen, die sie zu betreuen hatten, angemessener waren. Aber auch diese neuen Konzepte berücksichtigen die grundsätzlich (!) unterprivilegierte Lage der Mädchen und die besonderen, frauenspezifischen Sozialisationsbedingungen, denen diese unterworfen waren, zu wenig. Wohl wurde soziales Verhalten nicht allein von Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Gehorsam abhängig gemacht; wohl wurden Schul- und Berufsausbildung wichtig genommen; wohl wurde über das Thema der Sexualität frei gesprochen; auch die Problematik von Partnerbeziehungen hatte ihren Platz innerhalb der fortschrittlichen Pädagogik. Eine – im Sinn des Wortes – emanzipatorische Mädchenerziehung jedoch wurde bloß in Ansätzen geleistet. Mädchen aber, denen von Geburt an ein »typisch weibliches« Verhalten antrainiert wird, Mädchen, die kaum je für ihre intellektuellen Leistungen, aber immer wegen ihrer körperlichen Vorzüge, wegen ihres Aussehens soziale Anerkennung finden und schon von Kind an in der Familie gelernt hatten: Herr im Haus ist der Mann – solche Mädchen bedürfen einer konsequent emanzipatorischen Erziehungshilfe, weil sie anders keine Chance haben, sich von ihrer Rolle, Gebrauchsobjekt für Männer, Wirtschaft und Industrie zu sein, zu befreien.
Die Masse der Mädchen in den konventionellen Heimen wird noch immer nach dem Frauenbild Jahrgang 1900 oder 1910 erzogen. Fleißige Lieschen, gehorsame Lieschen, bescheidene Lieschen. Hände weg von den Männern; alle sind schlecht. Außer der eine, der Traumprinz, der dir einst die Gnade erweisen wird, dich zum Traualtar zu führen. Noch immer geht's ums Ruhigstellen, ums Anpassen, um das, was die Verantwortlichen Resozialisierung nennen.
Marie: Ich hoffe, daß sich endlich etwas ergibt. Daß ich erstmals genaue Angaben gesagt bekomme, was wirklich die Wahrheit sein sollte. Ich will nämlich mein wahres Recht auf die Freiheit, die brauch' ich zum Leben.
Auch totale Systeme haben Risse und Ritzen. Wo Ordnung oberstes Gesetz ist, wird Unordnung zur notwendigen Überlebenstechnik. Aufsässigkeit und Ungehorsam breiten sich aus unter den Mädchen. Die eingesperrte Sexualität sucht heimliche Wege, sich zu befreien. Nichts Böses geschieht, aber viel Verbotenes. Immer wieder. Weil fast alles verboten ist, geschieht viel Verbotenes. Erzieherinnen, die sich tolerant nennen, schauen lieber weg, wollen nichts gesehen haben. Das ist besser als Verhöre anstellen, Mädchen ausfragen und – vielleicht – bestrafen zu müssen.
Tolerieren ist bequem: die Erzieherinnen weichen, indem sie wegschauen, den – wie sie vermuten – peinlichen, intimen, unangenehmen Fragen der Mädchen aus. Sie wüßten auch keine Antwort auf die Fragen. Erzieherinnen, die von toleranter Gleichgültigkeit nichts halten und sich auf ernsthafte Gespräche mit den Heimzöglingen einlassen, sind selten. Die wenigen, die es gibt, werden bestürmt und belagert. Die seelisch ausgehungerten und vielfach zu kurzgekommenen Mädchen klammern sich an den, der sie menschlich behandelt und der ihnen auf ihre Fragen Antwort gibt.
Aus Briefen an eine Erzieherin, der die Heimmädchen vertrauten:
… Sie werden denken, sie sagt (bloß), sie hat mich gern. Ja, es stimmt, ich habe Sie gern wie eine Mutter. Sie haben sich ein bißchen verändert. Bitte seien Sie mir nicht böse … Ich habe Sie von Anfang an gern gehabt. Eine Bitte hätte ich, wenn es Ihnen ausgeht: könnt ich mit Ihnen reden … (Lisi)
… Möchte mich gern wegen meines gestrigen Benehmens entschuldigen. Aber bitte, glauben Sie mir, daß die Tabletten nicht von meiner Mutter waren. Elke und ich werden uns wieder zusammenreißen, das verspreche ich Ihnen. Bitte verzeihen Sie mir. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, aber nur, wenn Sie überhaupt noch mit mir sprechen. Das weiß ich ja nicht. Wissen Sie, Fräulein Z., Sie sind der einzige Mensch, den ich sehr, sehr gern hab, auf der ganzen Welt. Bitte, wenn Sie den Brief gelesen haben, dann zerreißen Sie ihn … (Silvi)
… Fräulein Z., ich möchte raus! Bitte helfen Sie mir, denn ich vertraue Ihnen. Ich halte aus und suche mir eine Arbeit. Ich mag Sie so gerne. Ich schreibe Ihnen jetzt meinen Lebenslauf auf, damit sie wissen, warum ich mit den Nerven am Ende bin … (Renate)
… Wir haben ja sonst niemand außer Ihnen. Wenn wir auf Flucht gehen, dann haben wir nur Sehnsucht nach Ihnen. Denn Ihre Nähe strömt so viel Wärme aus wie von einer Mutter. Als ich Ihre Mutter sah, da dachte ich mir, das Fräulein Z. hat eine so liebe Mama. Man kann Sie richtig beneiden. Ich auf jeden Fall tue es. Ich wünschte mir immer gute Eltern. Aber leider blieb dies erfolglos. Kurz und gut, wenn ich entlassen bin, da habe ich außer W. (dem Freund) und Ihnen niemand. Fräulein Z., ich sagte zu Ihnen in der Waschküche einmal: Sie sollen mich adoptieren. Warum geht das nicht? Ich möchte einmal im Leben richtige Wärme haben. Die kann mir W. (der Freund) leider auch nicht geben … (Rikki)
… Jetzt ist die Stunde des Abschieds gekommen. Es tut mir leid, denn Sie waren der einzige Mensch in diesem Haus (Heim), zu dem ich Vertrauen hatte. Es ist nicht viel, was ich Ihnen zum Abschied gebe … Sie haben mir Mut gemacht, als ich knapp an einer Flucht war und jetzt weiß ich, daß ich durchhalten werde … (Linda)Flucht aus dem Heim
Je strenger geführt, je geschlossener die Heime, desto öfter versuchen die Mädchen zu flüchten. Sie können nicht immer sagen, warum sie flüchten. Die drehen durch, weil sie sich nicht zwangsanpassen wollen und das Eingesperrtsein nicht aushalten. Ohne Ausweis, ohne Geld im Dschungel unserer Freiheit, das heißt für viele Mädchen, in andere Zwänge, in andere Abhängigkeiten zu kommen.
TonbandprotokolleBreit: Damals warst Du dreizehn-vierzehn Jahre. Und Du bist wieder aus dem Heim abgehauen. Wie bist Du durchgekommen?
Laura: Ja, was hab ich da getan? I hab an Burschen kenneng'lernt, dem hab i g'sagt, daß i Geld verdienen will. Der hat mi dann einfach auf'n Strich g'schickt. Die Hälfte von dem, was mir die Kundn zahlt habn, hab i ihm geben müssn. I bin aber nur zwoa Tag gangen. Z'erst bin i gar nit mitkommen, was die Kundn von mir wollen. I bin dem Burschn einfach abg'haut. In Kärnten hat mi ein anderer in sein Zimmer g'schleppt – i hab ja irgendwo übernachtn müssen – aber dort hat er mi also festg'haltn und hat mir Männer aufs Zimmer gebracht, die haben bezahlt dafür.
Erika: Wie i vom Heim abg'haut bin, hab i mei Mutter ang'rufn, sie soll mir a Geld gebn. Sie hat g'sagt, sie gibt mir kans, außer wenn i heimkomm. I war ja nit bleed, wenn i hoamkommen wär, hätt sie die Fürsorge oder die Polizei auf mi g'hetzt. Die alten Freund warn a nimmer da. Der ane war auf Entziehungskur, der andere war eing'sperrt, der nächste is nach Nepal oder sonst wohin g'fahrn – es war einfach kaner mehr da, den i kennt hab. So hat's nit weitergehn können. Wie i da im Prater herumgestreunt bin, is aner kommen, der hat g'sagt: Hearst, geht was? Da hab i nimmer g'wußt, was is sagn soll, na klar, bin i mit dem gangen. Nach ein paar Tag hab ich in einem Café angefangen zu arbeiten.
Breit: Was hast Du dort gearbeitet?
Erika: I war Bardame, i hab dort getanzt, Striptease, und hab auch so alles gemacht.
Breit: Wie alt warst Du damals?
Erika: So 14, 15 Jahr.Heimerziehung IV
Mädchen, denen es gelingt, sich den Normen und Vorschriften des Heimes anzupassen, Mädchen, die es also schaffen, lang genug brav, ordentlich und folgsam zu sein, werden auf Probe in die »Freiheit« entlassen. Sie werden schnell – in irgendeinem Wohnloch, bei Verwandten oder sonstwo – untergebracht. Jedenfalls dort, wo's wenig kostet. Der Staat will sparen, wo's nur geht. Und die Mädchen können sich bei ihrem miesen Verdienst – falls sie überhaupt Arbeit gefunden haben und etwas verdienen (dürfen), sowieso nur das Einfachste leisten.
Mädchen, die ständig heruntergemacht worden sind, denen man jahrelang eingebleut hat, daß sie nichts taugen, haben gute Ohren für das, was die Leute um sie herum sagen. Sie hören alles; vielleicht zuviel. Sie beziehen alles auf sich, weil sie glauben, jeder sieht, daß sie gezeichnet sind.
Wie i aus dem Heim auserkommen bin, war's unheimlich schwer für mich. Ich hab glaubt, jeder Mensch merkt mir's an, daß i aus einem Heim komm. Es ist so, als ob du auf der Stirn ein Zeichen Hättest! Einen haufen Minderwertigkeitskomplexe hat man ja sowieso, dein Selbstbewußtsein ist total weg. Total! Du traust di nit allein in ein G'schäft oder in ein Lokal, so scheu bist du g'worden. I hab so Angst g'habt vor dem, was die Leut von mir denkn. I hab wirklich glaubt, daß mir die Leute alle ansehen, daß i im Fürsorgeheim war … (Gitti, 17)
Anni F., (Sozialarbeiterin, war lang in der Nachbetreuung von Heimmädchen tätig): Meine Chefs vom Jugendamt haben mich gewaltig unter Druck gesetzt; die verlangten von mir, daß ich die Mädchen in kürzester Zeit in irgendeinen Betrieb unterbringe, ganz egal, ob dort die Arbeit und die Arbeitsbedingungen gut, mäßig oder saumies waren. So konnte die Resozialisierung eben auf keinen Fall klappen. Erstens kriegst du nur unterklassige, ungesunde Schmutzarbeit – vor der sogar die Gastarbeiter davonlaufen – für diese Mädchen, die nichts können. Zweitens schaffen es die Mädchen nicht, so miese Jobs durchzuhalten, auch dann nicht, wenn sie's – mir zuliebe, weil sie merken, daß ich von oben unter Druck stehe – durchhalten möchten. Die haben doch während ihrer Heimzeit nie eine positive Beziehung zur Arbeit gelernt. Nie haben sie anhand qualifizierter Tätigkeiten Interesse und Selbstsicherheit entwickeln können. Die idiotische Beschäftigungstherapie – Socken stopfen, Wäsche bügeln auf den Millimeter genau – haben sie doch bloß als Strafe, als Schikane erlebt.
Wenn die Mädchen einmal entlassen sind, dann durchschauen sie den Schwindel, der mit ihnen betrieben worden ist. Die Eingeschüchterten, die psychisch »Niedergeschlagenen«, die unsicher Gehaltenen lassen sich eine Zeit lang – wenn sie einen bekommen haben – nahezu alles von ihrem Chef und den Kollegen gefallen. Sie werden herumkommandiert, angeschrien. Oft drängt man sie mit Gewalt in die Rolle der Betriebssündenböcke. Zu kämpfen um Anerkennung, sich durchzusetzen und Schwierigkeiten durchzustehen haben sie nie gelernt im Heim. Wenn man immer nur sich anpassen muß, lernt man das nicht. Und wenn die Hemmungen der Mädchen sich steigern, wenn die Angst immer größer wird, geben die Mädchen eines Tages auf. Sie melden sich krank, machen blau, bleiben daheim. Ihren Job sind sie sofort los.Anni F. (s.o.): Täglich erleben die Mädchen – vor allem dann, wenn sie gut aussehen –, welche Rolle sie in der (Männer-)Gesellschaft spielen (sollen): nicht ihre Leistungen sind geschätzt und begehrt, niemand fragt nach ihrer Bildung. Aber: Ihr einziges, ihr wertvollste Kapital ist ihr Aussehen, ist ihr Körper. Für mich war's in der Nachbetreuung wahnsinnig schwer, mit den Mädchen, die von ihrer Meinung nicht abweichen wollten, zu diskutieren: »Ich geh doch für so einen reichen Stinker nicht an ganzn Monat arbeitn! Für viereinhalbtausend Schilling!« erklärten sie mir. »Da verdien ich ja in einer Bar oder auf dem Strich in ein paar Tagen.« Diesem Standpunkt hatte ich wenig entgegenzusetzen, was auch für die Mädchen glaubwürdig und überzeugend gewesen wäre.
Die Mädchen auf Probe in der Freiheit sind meist dankbar, wenn sie irgendwo Anschluß finden. Besondere Ansprüche zu stellen, können sie sich nicht leisten. Hauptsache, sie stoßen zu einer Clique, von der sie akzeptiert werden und in der was los ist. Die Mädchen wollen Leben nachholen, sie wollen ihre Selbstsicherheit zurückgewinnen. Das kann nur in der Gruppe gelingen, allein würde das kein Mädchen schaffen. Daß in den Cliquen, die mit Vorliebe Mädchen aus Heimen aufnehmen, merkwürdig oft Zuhälter, Loddel, Peitscherlbuab'n die Bosse und Anschaffer sind, ist kein Zufall: die cleveren Strizzis haben immer schon mit Nachwuchs aus Fürsorgeheimen Geschäfte gemacht.
G. Qu. (Fürsorgeerzieherin): In dem Heim, in dem ich vor etwa zehn Jahren angefangen hab, war's ganz arg. Jeden Freitag und Samstag sind die Zuhälter mit ihren tollen Schlitten vor dem Tor vom Heim g'standen und haben sich die Mädchen geangelt. Logisch, daß unsere Mädchen diesen raffinierten, charmanten Herren und ihren Schmähs so leicht auf den Leim gegangen sind: Sexualität war in unserem Heim tabu. Bei uns herrschten geradezu mittelalterliche Ansichten. Einem Mädchen zum Beispiel, das am ganzen Körper Ekzeme hatte, wurde ernsthaft eingeredet, diese »Krätzen« kämen als Strafe fürs Onanieren!
Ich bin einmal in einer Gruppe 15-, 16-jähriger Mädchen spazieren gegangen. Am Weg pinkelte gerade ein kleiner Bub. Die Mädchen haben diesen Buben umringt und haben ihm ganz gerührt zugeschaut. Die Mädchen sind richtig ausgeflippt beim Zuschauen. Aber gerade diese Mädchen waren es, die den Zuhältern am leichtesten auf den Leim gingen. Ein paar der Mädchen sehe ich heute noch gelegentlich; sie sind jetzt etwa 25, 26 Jahre und haben immer noch die größten Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität. Eine zum Beispiel, die, bis sie achtzehn war, in einem geschlossenen Heim aufg'wachsen ist, ist vollkommen unaufgeklärt aus dem Heim herausgekommen. Die hat noch nicht einmal gewußt, wie ein Mann ausschaut. Zwei Monate nach ihrer Entlassung war sie schwanger. Jahrelang ist sie danach noch auf den Strich gegangen. Wer weiß, was aus ihr geworden ist.Klubenschedl (Profi des Nachtgeschäfts, hat es vom Zuhälter zum Saunaboß gebracht): Aufgebaut und hergerichtet für den Strich ist so ein Mädchen aus einem Heim ziemlich schnell. Die haben doch hinten und vorn nix, absolut nix: Höchstens einen Scheißjob, der ihnen zum Hals heraushängt. Und Flausen vom ganz großen Glück. Du machst also zuerst auf Liebe, bratest sie anständig ein, dann laßt die schönsten Drachen steigen: von der gemeinsamen Zukunft und so. Wenn der Schmäh hineingeht bei ihr, laßt du sie die starke Hand spüren, damit sie merkt, wer der Chef ist. Dann geht sie bald brav anschaffen und bringt viel Kohle.
Sigrid (Mädchen mit Stricherfahrung): Da hab i zwa Burschn kennengelernt, die haben mich ständig vergewaltigt, die habn mir die Puffn unten eing'führt und habn zu mir g'sagt: Madl, wenn'sd die Goschn aufreißt, dann druck i ab. Dann hab i die Urschläg gekriegt. I hab ja nit weggehn können von denen, die habn g'wußt, daß i auf den Strich geh und die haben g'wußt, wo i wohn, die habn richtig Leut auf mi ang'setzt. Wenn i nit in ihr Stammcafé W. kommen bin, habn s'mich einfach dahin schleifen lassen. Morddrohungen hab i von denen aa gekriegt, i hab so Angst g'habt, daß i schon zur Polizei gehn wollt, obwohl mi die Kieberei ja g'sucht hat. Die zwei wollten, daß i für sie auf den Strich geh, aber ich hab g'sagt: mich könnt's am Arsch leckn, weil, wann i geh, dann geh i für mi allaan, aber nicht für euch. Auf jeden Fall war i jeden Tag voll mit Valium. I hab mir a (Zehner) Valium aufg'löst in Kaffee und hab mir g'sagt: trink das, weil dann war i ruhiger und hab vor mich hintörnt und da waren mir die Watschen egal, die i gekriegt hab. Die haben mir ja auch die Tschigg auf die Händ ausgetötet, i hab heut noch die Narbn.
Wenn amtsbekannt wird, daß ein auf Probe entlassenes Mädchen auf den Strich geht, statt in die Fabrik oder zum Tellerspülen, werden die zuständigen Damen und Herren aktiv. Man bestätigt sich gegenseitig, daß man überrascht, entsetzt, betroffen sei. Andererseits bestätigt man sich gegenseitig, daß man – im Grunde genommen – diese Karriere längst vorausgesehen habe.Anni F. (s.o.): Ich habe meine Gründe, warum ich heute nicht mehr als Nachbetreuerin von Heimmädchen arbeiten will. Ich halte es für grundfalsch, wenn ein Mädchen, das »strichverdächtig« ist, von den Fürsorgebehörden so schnell fallengelassen und ins Out abgeschoben wird. Viele der sechzehn-siebzehnjährigen Mädchen, die auf den (Gelegenheits-) Strich gehen, tun dies doch selten freiwillig aus eigenem Entschluß, sondern weil sie von Freunden, von brutalen Lokalbesitzern, von Zuhältern, von Frauen – sicher auch durch finanziellen Druck – dazu genötigt werden. Gerade in dieser Notsituation bräuchten die Mädchen wirksame Hilfe, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen.
Genau das aber verweigern ihnen die Behörden. Die wollen weghaben, verdrängen, was in ihnen Ängste und Aggression weckt. Es war bezeichnend, wie abwertend, wie verächtlich Beamte über diese Mädchen und deren »Ausschweifungen« gesprochen haben. Ich merkte so richtig, wie es manchen Lustgefühler verschaffte, wenn sie von meinen Klientinnen vor mir – vor einer Frau also – in der gängigen vulgären Ausdrucksweise reden konnten. Einem einzigen höheren Beamten bin ich im Landesjugendamt begegnet, der die Situation der Mädchen halbwegs richtig eingeschätzt hat und zugab:
Eigentlich müßten wir gerade diesen Mädchen ganz besonders helfen. Obwohl er das einsah, hat dieser Beamte nichts getan, was eine langfristige, intensive Betreuung möglich gemacht hätte. Er könne doch nicht Mädchen unterstützen, die auf den Strich gehn, erklärte er, das sei doch ungesetzlich. Das einzige, wozu er bereit war: Er schob in Einzelfällen die Aufhebung der Fürsorgeerziehung ein, zwei Monate hinaus. Ich sollte dann in dieser lächerlich kurzen Zeit alles in »Ordnung« bringen: die Mädchen vom Strich abbringen, ihnen einen Job verschaffen, womöglich auch ein neues Zimmer suchen und vor allem: sie vor der Wut ihrer Freunde schützen, die kein Interesse daran hatten, daß die Mädchen mit dem Anschaffen aufhörten.«
Ich danke Frau Doktor Trautl Brandstaller, die mir vor sieben Jahren den Auftrag gab, einen längeren Prisma-Beitrag für das Österreichische Fernsehen zu drehen. Dieser Auftrag ermöglichte mir den Einstieg in dieses Thema.